Der Föderalismus ist ein Grundpfeiler der politischen Schweiz. Dem Subsidiaritätsprinzip folgend erhält die kleinste Einheit ein Maximum an Selbstbestimmung. Denn, so die Idee: Solange diese kleinste Einheit über die entsprechenden Ressourcen verfügt, weiss sie am besten was zu tun ist.
Selbstbestimmte Identität an der Fachtagung «Educa23»
Interessanterweise existieren im digitalen Raum – konkreter beim Umgang mit digitalen Identitäten und deren Daten – unter dem Stichwort «selbstbestimmte Identität» dieselben Überlegungen. Warum sollen die Daten eines Individuums nicht beim Individuum selbst aufbewahrt werden? Für lange Zeit lautete die Antwort: Weil es technisch schwer machbar ist.
Aktuelle technologische Entwicklungen bieten nun Möglichkeiten für die selbstbestimmte Verwaltung der digitalen Identität und der damit verbundenen Daten. Dadurch gewinnt auch die Diskussion um die «selbstbestimmte Identität» an Relevanz. Ermöglicht wird dies beispielsweise durch Blockchains. An unserer Fachtagung am 21. Juni 2023 zum Thema «Blockchains in der Bildung» schauen wir uns unter anderem diese Diskussion im Bildungskontext an.
Chloés Prüfungsergebnisse: selbstbestimmt verwaltet
Wie die selbstbestimmte Datenverwaltung für eine Lernende ganz konkret aussehen könnte, zeigen wir in unserer dritten Episode der Videoserie zum Thema «Blockchains in der Bildung». Darin lernen wir Chloé kennen. Sie reicht alle notwendigen Leistungsnachweise für ihr EFZ als Gärtnerin ein. Diese Leistungsnachweise verwaltet sie selbstbestimmt bei sich.
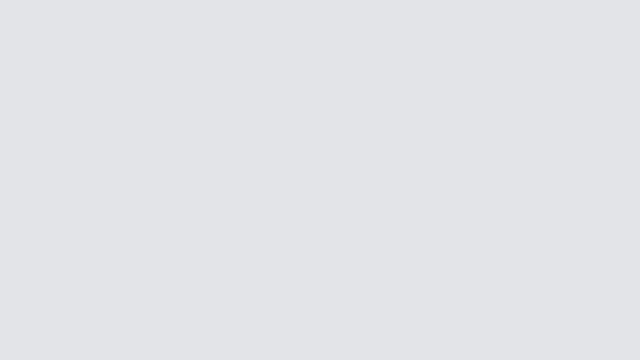
Haben Sie die vorherigen Episoden verpasst?
Alle Episoden der Videoserie zur Blockchains in der Bildung finden Sie an einem Ort.