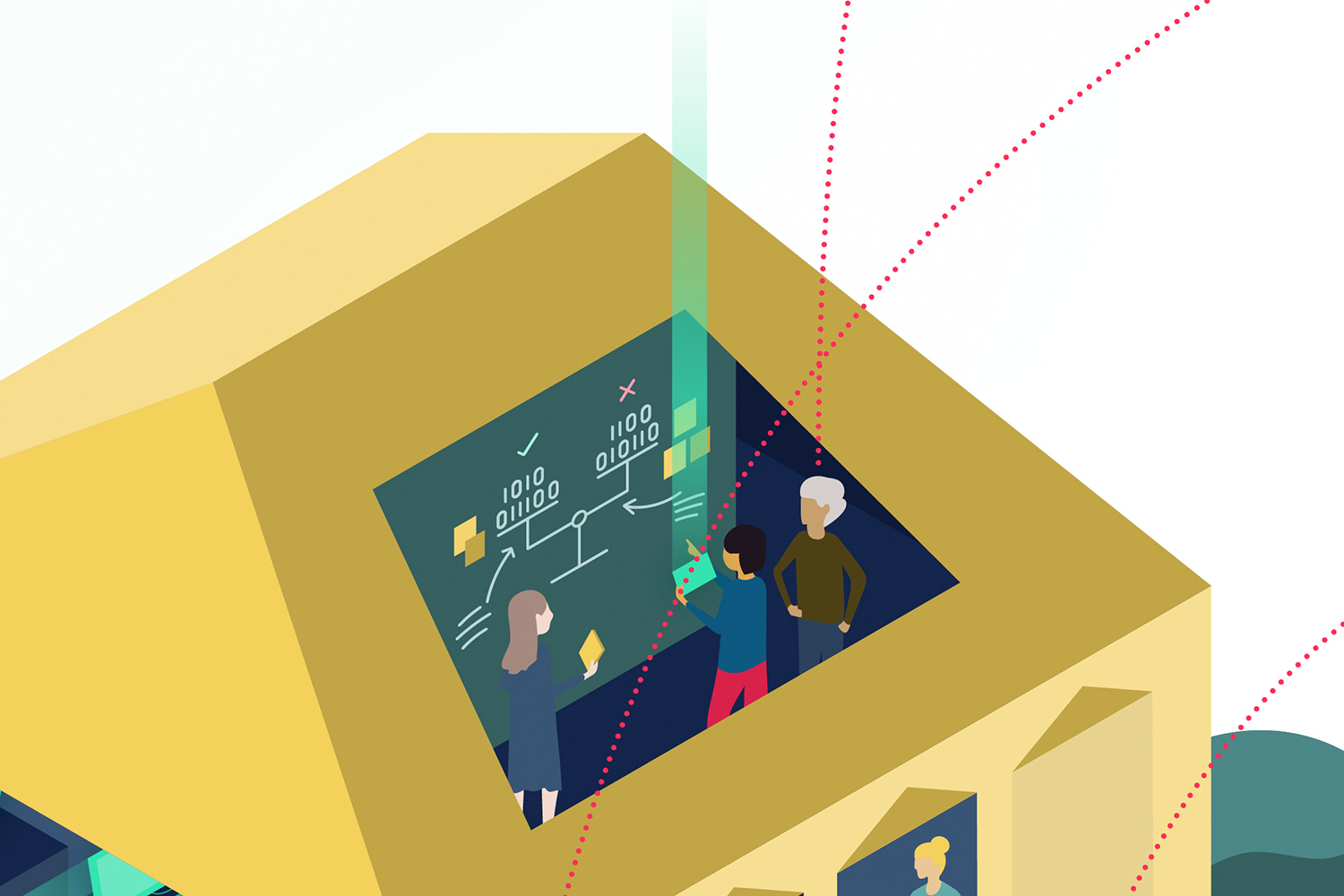
Daten, bzw. deren Austausch in Form von Datenflüssen, bilden die Grundlage für die Datennutzung in einem Bildungsdatenraum. Daher ist es zentral, Datenflüsse erfassen, beschreiben und bewerten zu können. Die Vielfältigkeit des Schweizer Bildungsraums stellt für diese Aufgabe eine Herausforderung dar. So werden im Bildungssystem täglich Daten zu sehr unterschiedlichen Zwecken und zwischen verschiedenen Akteuren ausgetauscht.
Einen Teil dieser unterschiedlichen Datenflüsse haben wir mit Ihrer Hilfe erfasst um eine Übersicht der Datenflüsse im Bildungsraum zu gewinnen. Auf diese Weise wollen wir ein Verständnis dafür entwickeln, welche Datenflüsse funktionieren, wo es Herausforderungen gibt und wo Datenflüsse nicht existieren, obwohl dies sinnvoll wäre. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich Vorschläge zur Verbesserung der Datennutzung ableiten.
Wo fliessen heute schon Daten?
Die Rückmeldungen zu unserer Umfrage geben Anhaltspunkte dafür, zwischen welchen Nutzungskontexten heute im Bildungssystem Daten fliessen. Die untenstehende Grafik zeigt die in der Umfrage erfassten bestehenden Datenflüsse für alle Nutzungskontexte.
Am meisten Daten fliessen grundsätzlich innerhalb, seltener zwischen den Nutzungskontexten. Der Nutzungskontext «Lehren & Lernen» tauscht dabei am meisten Daten aus. In den Datenaustauschen geht es beispielsweise um den Versand von Schulnoten, den Inhalt von Schulfächern oder die Koordination bei Massnahmen zum Nachteilsausgleich. Auch innerhalb des Nutzungskontextes «Bildungsverwaltung & Schulorganisation» fliessen viele Daten. Entsprechend dem Nutzungskontext werden hier vor allem Daten zur Planung und Organisation ausgetauscht, beispielsweise zur Planung des nächsten Schuljahres oder des Bildungsangebotes.
Bei den Datenaustauschen zwischen Nutzungskontexten sind das «Lehren & Lernen» und die «Bildungsverwaltung & Schulorganisation» bezüglich Anzahl Datenaustausche gemäss Umfrage führend. So werden insbesondere zum Zweck der Schulorganisation Daten ausgetauscht, beispielsweise Stammdaten von Schülerinnen und Schülern, Daten zur Finanzierung und Umsetzung von Massnahmen für Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf oder bei Neueintritten zum Niveau der Schülerinnen und Schüler. Zum Zweck dieser Datenaustausche wird in der Umfrage treffenderweise erwähnt, dass dadurch das «Lehren & Lernen» von administrativen Abläufen entlastet werden soll und sich entsprechend auf den Unterricht konzentrieren kann.
Innerhalb und zwischen den restlichen Nutzungskontexten zeigt die Umfrage nur sehr vereinzelte Datenaustausche. Genannt werden Datenflüsse zwischen «Anderen Sektoren» (konkret der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung) und der «Bildungspolitik & Steuerung» zum Zweck des Bildungsmonitorings oder die Lieferung von Daten ans Bundesamt für Statistik im Rahmen der Bildungsstatistik.
Wählen Sie die Perspektive ihres Nutzungskontextes
Rechtliche Regelung von Datenflüssen
Teilweise sind Datenflüsse gesetzlich klar geregelt. Dies erleichtert die Nachvollziehbarkeit der ausgetauschten Daten. Nichtsdestotrotz besteht die Herausforderung in der heterogenen technischen Umsetzung der diversen Datenflüsse. Wo Datenaustausche nicht gesetzlich vorgegeben werden, ist es herausfordernder diese abzubilden. Beispielsweise ist es schwierig, Datenflüsse, die im Unterricht stattfinden, innerhalb des Nutzungskontextes «Lehren & Lernen» im Detail nachzuvollziehen.
Die Resultate der Umfrage sind eindeutig. Bei allen gemeldeten Datenflüssen sind die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer davon überzeugt, dass sie rechtlich gesehen stattfinden dürfen. Gegeben die Inhalte scheinen tatsächlich die allermeisten Datenflüsse im Rahmen des breit gefassten Bildungsauftrags abgewickelt zu werden.
Ethische, moralische und praktische Überlegungen zu Datenflüssen
Daneben bestehen im Bildungssystem aber auch Datenflüsse, die nicht zwingend stattfinden sollten – selbst wenn sie rechtlich zulässig sind. Eine solche Einschätzung kann vor dem Hintergrund unterschiedlicher Überlegungen zustande kommen – seien sie zum Beispiel ethischer, moralischer oder rein praktischer Natur. In die Kategorie der Datenflüsse, die aus praktischer Sicht nicht zwingend stattfinden sollten, fallen jene, die zu unnötigem Verwaltungsaufwand führen. Ein Beispiel ist hier die wiederholte Übermittlung von Stammdaten an öffentliche Stellen. Denn: Sie widerspricht dem Ziel der Einführung des Once-Only-Prinzips.
Der Wunsch des «nicht-stattfinden-Sollens» kann aber auch Ausdruck einer individuellen Präferenz oder eines kollektiven Unbehagens sein. Ein Beispiel dafür wäre eine Akteurin aus dem Kontext Bildungspolitik und -steuerung, die Lernendendaten auf einer Cloud im Ausland speichert. Diese Speicherung ist unter bestimmten Umständen rechtens, kann aber bei vielen Akteuren auf Ablehnung stossen. Ähnlich ist die Situation, wenn Daten aus der Nutzung einer Schulsoftware durch Lernende an eine Softwareanbieterin oder ihre Subunternehmen fliessen. Auch wenn das Unternehmen die geltenden Regeln einhält, kann ein solcher Datenfluss kontrovers diskutiert werden.
Dies umso mehr, als im Bildungssystem unterschiedliche Abhängigkeiten bestehen: So sind beispielsweise Schulen bei der Gestaltung ihrer Datenflüsse bis zu einem gewissen Grad von den grossen Unternehmen im Bildungsmarkt abhängig. Gleichzeit bestimmen aber die Schulen mit ihren Entscheidungen über die Datenflüsse einer Vielzahl von Lernenden, ohne dass Letztere eine Möglichkeit auf Vermeidung dieser Datenflüsse hätten.
Auch in Bezug auf die ethische Frage zu den Datenflüssen zeigt unsere Umfrage ein klares Resultat. Die erfassten Datenflüsse werden allesamt als ethisch vertretbar eingestuft und sollen gemäss den Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmen entsprechend stattfinden.
Technische Umsetzung der Datenflüsse
Selbst wenn für Datenflüsse rechtliche Grundlagen und Normen formuliert sind, lässt die technische Umsetzung der Vorgaben immer noch Spielraum bezüglich der Qualität eines Datenaustausches.
Fehlende Schnittstellen, mangelnde Datensicherheit, uneinheitliche Datenformate oder lückenhafte Dokumentationen der Datenaustausche sind Probleme, die durch eine unzureichende technische Umsetzung hervorgerufen werden können. Folgen dieser Probleme sind unter anderem häufige Medienbrüche, unsichere Datenflüsse, fehleranfällige oder veraltete Datengrundlagen und starke Abhängigkeiten von Einzelpersonen. Damit verbunden sind im harmlosesten Fall unnötige Aufwände, im schlimmsten Fall Datenlecks oder Fehlentscheide.
In der Umfrage stand für uns in erster Linie im Vordergrund, ob Datenflüsse automatisiert stattfinden, weil dadurch oftmals die Fehlerquellen minimiert und damit die Qualität der übermittelten Daten verbessert werden kann. Über die ganze Umfrage gesehen werden die Datenflüsse aktuell hälftig automatisiert beziehungsweise manuell abgewickelt. Automatisierte Datenflüsse wurden zum Beispiel in der Datenübermittlung ans Bundesamt für Statistik im Rahmen der Bildungsstatistik oder bei der Meldung von Stammdaten zur Schul- und Klassenzuteilung berichtet. Also oft dann, wenn Akteure aus unterschiedlichen Nutzungskontexten beteiligt sind.
Manuelle Datenflüsse sind innerhalb des Nutzungskontextes «Lehren & Lernen» weit verbreitet. Dies erscheint einleuchtend vor dem Hintergrund, dass diese Datenflüsse oft innerhalb einer Schule stattfinden. Auch alle erfassten Datenaustausche mit dem Nutzungskontext «Andere Sektoren» funktionieren manuell, allenfalls weil diese weniger stark formalisiert sind.
Potenzielle Datenflüsse
Schliesslich gibt es Datenflüsse, die beispielsweise aus ethischen oder strategischen Überlegungen wünschenswert wären, aber aus unterschiedlichen Gründen (z.B. rechtliche Hürden) nicht stattfinden, obwohl dies für das Bildungssystem ein Zugewinn wäre. In diese Kategorie fallen Datenflüsse, die das Bildungssystem effizienter und effektiver gestalten könnten, wenn sie denn existierten.
Effizienzgewinne wären beispielsweise im Berufsbildungssystem denkbar, wenn Daten im Kontext der Bildungsverwaltung und Schulorganisation über Kantonsgrenzen hinweg einfacher und standardisierter ausgetauscht werden könnten (vgl. SDBB 2023). Zur Effektivität des Bildungssystems könnten Datenflüsse beitragen, wenn sie Individualdaten aus der Bildungspolitik und -steuerung unkompliziert und anonymisiert der Bildungsforschung verfügbar machen würden. So könnte die Bildungsforschung Projekte und Programme im Bildungssystem evaluieren und Evidenz dazu liefern, was funktioniert und was nicht.
Gemäss unserer Umfrage scheint es vor allem innerhalb des «Lehren & Lernens» noch Verbesserungspotenziale für Datenaustausche mit den Schulpsychologischen Diensten, bei Fragen rund um Beistandschaften für Kinder oder bei ausserkantonalen Berufslernenden zu geben. Die Umfrageresultate zeigen zudem, dass rund um das Thema «Nutzung von Daten für den Erkenntnisgewinn» Verbesserungspotenzial vorhanden ist. So soll der Bildungsmarkt anonymisierte Daten von Schülerinnen und Schülern an die «Bildungspolitik & Steuerung» übermitteln, um daraus bildungspolitische Entscheide ableiten zu können. Die Bildungsforschung wiederum wünscht sich bessere Daten zu Abschlussprüfungen und Qualifikationsverfahren, um Fragen rund um dieses Thema besser analysieren zu können.
Je mehr wir wissen, desto genauer wird vermessen
Die hier aufgezeigten Ergebnisse der Umfrage geben einen ersten – zugegebenermassen bruchstückhaften – Eindruck, wo im Bildungssystem überall Daten ausgetauscht werden. Bestehende Datenflüsse sollten künftig indes noch gezielter erfasst werden, beispielsweise in öffentlich zugänglichen Registern der Bearbeitungstätigkeiten von Bildungsverwaltungen und Schulen. Dies hilft um zu verstehen, wo:
- die rechtlichen Grundlagen für Datenflüsse bekannt sind, wo allenfalls nicht oder wo gar rechtliche Grauzonen bestehen;
- aus ethischen und praktischen Überlegungen der Schuh drückt und wo eine künftige Datennutzung der Ausformulierung von gemeinsamen Normen bedarf;
- Datenflüsse, die für das Bildungssystem zielführend wären noch nicht existieren.
Je mehr Datenflüsse bekannt sind, desto klarer können im Anschluss die Potenziale und Herausforderungen bei der Schaffung eines Bildungsdatenraumes ausformuliert werden, in dem Daten zum Wohle des Bildungssystems genutzt werden können.
Weiterführende Links
- Digitale Verwaltung Schweiz (2021). Behördenübergreifende Stammdatenverwaltung aufbauen.
- eCH (2024). Datenstandard Berufsbildung.